| Stephani- Volksschule |
|
| Grundschule | |
| Hauptschule | |
| Termine | |
| Aktuelles | |
| Schulgeschichte | |
|
Stephani-Volksschule Gunzenhausen Schulgeschichte |
Dr. Heinrich Stephani - Theologe, Pädagoge, Schulreformer
Nachdem sich für die Schulgebäude am Hindenburgplatz seit langem die Bezeichnung "Stephani-Schule" eingebürgert hatte, wurden Grund- und Hauptschule im Jahr 1981 offiziell nach dem Kirchenrat Dr. Heinrich Stephani (1761-1850) benannt, der von 1818 bis 1834 als Dekan und Stadtpfarrer in Gunzenhausen wirkte.
Schon frühzeitig war aus dem Theologen ein Pädagoge und Schulreformer geworden, dessen Bedeutung über die Grenzen Bayerns hinausreicht. Er erkannte die gesellschaftliche Funktion von Unterricht und Erziehung und legte als Erster einen umfassenden Entwurf für das gesamte Bildungssystem einer Nation vor. Mit seinen damals revolutionären und zum Teil noch heute einzulösenden Forderungen nach einer staatlichen Schule für alle Stände, allgemeiner Schulpflicht, gut ausgebildeten und gleich besoldeten Lehrern sowie nach fachlicher Schulaufsicht ist Stephani zu den Vätern des modernen bayerischen Schulwesens zu zählen.
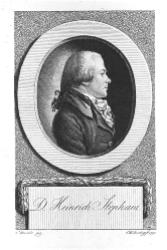
Die bayerische Regierung berief Stephani 1808 in den Schulaufsichtsdienst. Als Kreisschulrat des Lechkreises in Augsburg, ab 1809 zusätzlich als Kreiskirchenrat für den Lech-, Iller- und Altmühlkreis und schließlich ab 1811 als Kreisschulrat im damals neubayerischen Ansbach lernte er das darniederliegende Schulwesen kennen und kämpfte auch als Mitglied der Kammer der Reichsräte (1819) für Reformen.
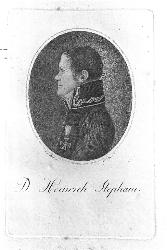
Allzu unbequem geworden, verdrängte man ihn mit fadenscheiniger Begründung und einem königlichen Verweis aus dem staatlichen Amt. "Demselben ist jedoch Unser gerechtes Mißfallen zu erkennen zu geben …" und " … aus Rücksicht auf die sonstigen verdienstlichen Bemühungen des Kreisschulrates Stephani im Fache des Schulwesens … "durfte er wohl seinen Titel als Kirchenrat behalten und sich um die vakante Stelle in Gunzenhausen bewerben.

Als führender bayerischer Vertreter einer rationalistisch orientierten Theologie geriet er immer mehr in Widerspruch zu den gerade in Gunzenhausen zahlreichen und als "Mystiker" oder "Montagsherren" bekannten Vertretern der evangelischen Erweckungsbewegung. 1834 wurde Stephani vom Dekanatsamt und von der Ausübung seiner pfarramtlichen Funktionen enthoben.
Nach erfolglosen Bemühungen um seine Rehabilitierung zog er 1841 zu seiner Tochter nach Gorkau in Schlesien. Er starb dort am Heiligen Abend des Jahres 1850. Lehrer trugen ihn zu Grabe. Seine Grabinschrift lautet:
"Das Jahrhundert war seinem Ideal nicht reif.
Er lebte, ein Bürger der Jahrhunderte, die kommen werden."
Dr. Heinrich Stephanis "einzig wahre Lesemethode"
Werden Lehrerinnen und Lehrer nicht bisweilen ungeduldig, wenn ihre ABC-Schützen länger als ein halbes Jahr brauchen, um das Lesen zu erlernen? Dabei hatte man es früher als ganz normal erachtet, wenn kluge Kinder vier Jahre dazu benötigten. Die entscheidende methodische Erleichterung beim Lesenlernen verdanken unsere Kinder Dr. Heinrich Stephani.
Die Methode, nach der Kinder seit der Antike allgemein das Lesen erlernten, heißt Buchstabiermethode. Wie Stephani im zweiten Bändchen seiner jährlich erschienenen Zeitschrift "Der baierische Schulfreund" schreibt, hat die Buchstabiermethode " … das Eigenthümliche, daß sie ihre Schüler anhält, die Namen der Buchstaben in der Reihenfolge einer jeden Sylbe herzusagen, die vom Lehrer vorgesprochene Sylbe dann nachzusprechen und damit so lange fortzufahren, bis denselben jede Sylbe und jedes Wort dadurch so mechanisch bekannt geworden ist, daß sie dann wirklich ohne Anstand fertig lesen können." Die Bezeichnung der Buchstaben im Alphabet war also Grundlage des Leselernprozesses. Die folgenden Spottverse beschreiben das noch deutlicher:
Wenn man "hoch" lesen will, spricht man ha-o-ce-ha.
Man tönet zweimal ha und ist darin kein a.
Klingt es nicht wunderlich, wenn man will "spielen"
sagen
Und kommt mit es-pe-i-e-el-e-en hervor;
Ein solch gezognes Spiel möcht' mich vom Lernen jagen.
So kommt ja allzuschwer der rechte Zweck hervor.
Stephani erkannte den entscheidenden Fehler der Buchstabiermethode darin, "daß sie die Nahmen der Buchstaben für ihre Laute hielt" und übersetzte "jedes sichtbare Lautzeichen in den hörbaren Laut."
Im 12. Bändchen seiner Zeitschrift, 1819 im hiesigen Dekanshaus verfaßt, berichtet Stephani sehr ausführlich, wie er auf die an und für sich simple Idee kam, "die ächten Lautzeichen in unserer Sprache von den unächten zu sondern" und welche beachtlichen Erfolge er damit erzielte:
"Zuerst theilte ich, um vor Selbsttäuschung gesichert zu seyn, meine Entdeckung einigen gelehrten Freunden in der Nähe zur Prüfung mit, von denen sie probehaltig gefunden wurde, hierauf machte ich mit meiner Methode den ersten praktischen Versuch an meiner ältesten, damals fünfjährigen Tochter. Ob ich sie gleich kaum täglich eine halbe Stunde unterrichtete, so hatte ich doch die Freude, sie in sechs Wochen zur vollen Lesefertigkeit zu bringen."
Bestätigt werden die raschen Leseerfolge auch von der Pfarrfrau Louise Brügel, geb. Wüstner. In ihren gegen Ende der sechziger Jahre aufgezeichneten, handschriftlich vorliegenden Lebenserinnerungen hält sie ein Ereignis aus der Zeit von 1815 fest, als die Familie nach Ansbach gezogen war: "Wir waren noch nicht lange in Ansbach, so ließ der Schulrat Stephani meine Mutter rufen. Es starb nämlich eine Frau, welche ein Institut gegründet hatte für kleinere Kinder von vier bis sieben Jahren. Meine Mutter war für diese Stelle vortrefflich geeignet und nachdem sie von Stephani aufgefordert war, sich zu bewerben, erhielt sie dieselbe. Ich begleitete meine Mutter einige Male zu Herrn Kreisschulrat, um das Lautieren von ihm selbst zu lernen und so konnten wir damals besser hierin Unterricht geben als die Lehrer, die die Methode nicht kannten."
1802 erschien Stephanis "Handfibel oder Elementarbuch zum Lesenlernen nach der Lautiermethode." 1817 waren 100 000 Exemplare abgesetzt. Bis 1868 erschienen 102 Auflagen. In einem "natur- und zweckgemäßen Stufengange fortschreitend" ordnete Stephani die Laute so an, daß sich das Kind die Buchstabenwelt selbständig erschließen kann, denn wer " … in der Selbsthülfekunst zaghaft ist und sich erst auf fremde Hülfe verläßt, der ist für diese Welt ein unglücklicher Mensch."
Dennoch versicherte sich Stephani - wie das Ansbacher Beispiel beweist - der Mithilfe der Mütter, erklärte ihnen seine Methode genau und machte ihnen Mut, "für die geistige Bildung ihrer Kinder in so weit mit thätig zu seyn … "
Seine Lesestücke sollten leicht verständlich sein und den Kindern gefallen. Sie dienten nicht nur der Hauptabsicht, dem Lesenlernen, sondern immer auch der moralischen Bildung der Kinder, wie das nachfolgende Beispiel beweisen kann.
Das habsüchtige Mädchen.
Ein gutes altes Mütterchen ging in die Kirche. Der Weg war glatt gefroren; sie fiel daher und konnte nicht wieder allein aufstehen.
Lisette, ein Mädchen von zwölf Jahren, ging vorbei,
und wurde von dem alten Mütterchen um Beistand angerufen.
Ja, sagte sie, wenn ihr mir einen Groschen geben wollt, so will
ich euch wohl helfen. Sie half ihr auch wirklich nicht eher, als
bis ihr die alte Frau einen Groschen zu geben versprochen hatte.
Pfuy der garstigen Habsucht.
Näheres über Stephanis Leben und Wirken findet sich bei:
Wilhelm Sperl: Dr. Heinrich Stephani, München 1940 (= Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns, 20. Band)
Max Liedtke: Heinrich Stephani (1761-1850) Neustadt/Aisch 1986 (= Fränkische Lebensbilder, 12. Band)
Franz Müller
|
|
| 2000-06-02 | |